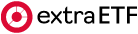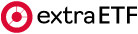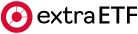Amazon schlägt Walmart – und dominiert dein ETF-Depot stärker als du denkst
Amazon macht mehr Umsatz als Walmart. Für dich als ETF-Anleger heißt das: Der Online-Händler prägt viele Indizes – und dein Depot – stärker als du denkst.

Broker-ETFs: Wo Scalable, Comdirect und Finanzen.net Zero sich unterscheiden
- Thomas Brummer
- 3. März 2026
Eigene ETFs vom Broker liegen im Trend. Doch wie unterschiedlich sind die Welt-Produkte vom Scalable Broker, Comdirect und Finanzen.net Zero wirklich?

Aufgrund der Iran-Krise geraten die Aktienmärkte unter Druck. Gerade jetzt sollten Anleger diese drei Fehler unbedingt vermeiden.

Nach Jahren der Underperformance und Kritik steht ESG vor dem Wendepunkt. Deshalb könnte nachhaltiges Investieren jetzt zurückkehren.

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Das ist der Sieger im März 2026.

"Die Monetarisierung von KI findet bereits statt"
- Markus Jordan
- 28. Februar 2026
Frank Thelen sieht die KI-Monetarisierung längst im Gange. Ein Gespräch mit dem bekannten Investor über die neuesten Entwicklungen.

Weltportfolio statt Home-Bias!
- Sponsored Content
- 27. Februar 2026
Globale Aktieninvestments sind heute selbstverständlich. Auch Privatanleger können weltweit Anlagechancen nutzen. Weltportfolio statt Home-Bias!

Griechenland rauf, Indonesien runter: Wenn MSCI entscheidet, beben die Börsen
- Thomas Brummer
- 26. Februar 2026
Griechenland steigt auf, Indonesien wackelt: Entscheidungen von großen Indexanbietern wie MSCI verschieben Kapitalströme – und bewegen ETF-Portfolios.

Die Bündel von Kraken ermöglichen eine breite Streuung im Kryptomarkt – ähnlich wie ETFs am Aktienmarkt, aber mit digitalen Vermögenswerten.

Gold: ETC vs. Bankschließfach – was der Bankraub von Gelsenkirchen lehrt
- Thomas Brummer
- 24. Februar 2026
Du hast Gold im Bankschließfach oder sogar daheim? Dann solltest du jetzt unbedingt über steuerfreie Gold-ETCs nachdenken.

Nicht nur Big Tech gewinnt: Warum dieser S&P 500 ETF aktuell besser läuft
- Thomas Brummer
- 23. Februar 2026
Der Markt wird breiter: Warum der gleichgewichtete S&P 500 den Klassiker schlägt – und was das für dein ETF-Portfolio bedeutet.

Rentenlücke bei jedem zweiten Deutschen: Mit ETFs entgehst du der Altersarmut
- Thomas Brummer
- 21. Februar 2026
Mehr als die Hälfte der Deutschen haben eine Rentenlücke von mehr als zehn Jahren. Du solltest frühzeitig gegensteuern, um für das Alter vorzubauen.

ELTIF – auf den Spuren einer neuen Anlageklasse
- Sponsored Content
- 20. Februar 2026
Hinter ELTIF verbirgt sich ein Fondskonstrukt, welches langfristig Kapital für wirtschaftliche Projekte bereitstellen soll.